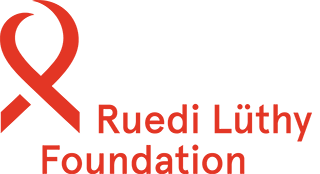Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. In der Schweiz kam das Leben Mitte März 2020 plötzlich zum Stillstand. Wie war das in Simbabwe?
So richtig los ging es Ende März, als die Regierung eine Ausgangssperre ankündigte. Wir haben via WhatsApp-Chat sofort das ganze Team kontaktiert. Wir mussten über das Wochenende so viele Patientinnen und Patienten wie möglich in die Klinik bitten, um sie mit HIV-Medikamenten zu versorgen. Ob sie später noch in die Klinik kommen können, war zu dem Zeitpunkt fraglich.
Wie ging es danach weiter?
Um funktionsfähig zu bleiben, haben wir zwei Teams gebildet, die sich wochenweise abwechselten. In die Klinik kamen nur Patientinnen und Patienten, die Medikamente benötigten oder akute gesundheitliche Probleme hatten. Am Eingang wurde Fieber gemessen, Masken verteilt und die Hände desinfiziert. Bei Verdacht auf Covid-19-Symptome wurden diese Personen in das zuständige Spital überwiesen.
Hat die Corona-Pandemie die Newlands Clinic stark getroffen?
Im Team hatten wir nur wenige Krankheitsfälle. Sie steckten sich im privaten Umfeld an und sind zum Glück wieder gesund. Es war eine grosse Umstellung für uns alle. Wir führten eine Zeitlang keine Fallbesprechungen durch und wegen dem ‹Social Distancing› fehlen wichtige soziale Momente wie das gemeinsame Mittagessen. Wir erinnern uns gegenseitig immer wieder an die Hygieneregeln und motivieren die Patientinnen und Patienten, sich auch zuhause zu schützen.
Wie wirkt sich die Situation auf die Therapie aus?
Der Weg zu uns in die Klinik ist für viele Patientinnen und Patienten schwierig geworden, wegen Polizeikontrollen und eingeschränkten Transportmöglichkeiten. Bei der Behandlung achten wir ganz besonders auf die Hygiene und halten soweit möglich Abstand. Das Zentrum für Frauengesundheit war im April 2020 geschlossen und die Hausbesuche mussten wir zeitweise unterbrechen. Patientinnen und Patienten, die nicht in die Klinik kommen, rufen wir an, um abzuklären, ob sie genug zu essen und Medikamente haben. Manchmal wohnt ein Teammitglied in der Nähe und kann die Sachen vorbeibringen. Zum Teil arbeiten wir auch mit lokalen Kliniken zusammen. Das funktioniert zum Glück gut: Bisher haben nur ganz wenige Patientinnen und Patienten die Therapie abgebrochen.
Die Armut in Simbabwe ist auch ohne Corona-Pandemie gross. Wie geht es den Menschen?
Wirtschaftlich ist die Situation sehr schwierig. In den ärmsten Gebieten, den sogenannten ‹High Density Areas›, arbeiten viele aber trotzdem weiter und verkaufen was immer möglich. Dazu hat mir jemand gesagt: «Erkranke ich an Covid-19, könnte ich sterben. Aber wenn ich zuhause bleibe, sterbe ich an Hunger.» Das beschreibt die Lage vieler Menschen ziemlich
genau.
Inwiefern konnten Angebote wie das Berufsausbildungsprogramm oder Selbsthilfegruppen noch durchgeführt werden?
Das war und ist schwierig. Die Gruppentherapien, die es zum Beispiel für junge Mütter oder Jugendliche gibt, mussten wir wegen der Schutzmassnahmen leider abbrechen. Als kleinen Ersatz bieten wir via Telefon Unterstützung an. Auch das Berufsausbildungsprogramm mussten wir teilweise aussetzen. Doch trotz allem konnten wir im letzten Jahr erstmals das Frauenförderungsprogramm starten, das Patientinnen hilft, eine Lebensgrundlage aufzubauen.
Wie geht es dem Team?
Die Pandemie trifft uns alle. Wir sind aber vergleichsweise privilegiert: Wir können zur Arbeit gehen, uns gegenseitig unterstützen, haben einen Lohn, Masken, Schutzbekleidung
und genug zu essen. Es ist an uns, etwas an unsere Patientinnen und Patienten weiterzugeben.
Wir wollen ihnen so viel Sicherheit und Stabilität bieten wie möglich.
Ruedi Lüthy konnte über ein Jahr nicht vor Ort sein. Wie wirkt sich das aus?
Er fehlt uns sehr. Wir haben von Prof, wie wir ihn nennen, so viel gelernt und können das nun weitergeben. Mitgefühl für die Patientinnen und Patienten ist das Wichtigste. Wir können alle einen Beitrag dazu leisten, dass es ihnen besser geht — vom Chauffeur bis zum Arzt. Das haben wir von Prof gelernt.
Wie geht es nun weiter?
Am Anfang war die Angst gross, doch mittlerweile haben wir gelernt, mit Covid-19 zu leben. Irgendwann geht auch dieser Sturm vorbei. Wir tun, was in unserer Macht steht. Wenn wir jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, dann tun wir das. Dafür sind wir da.
Weitere spannende Themen finden Sie in unserem Jahresbericht 2020.
Jahresbericht: «Irgendwann geht auch dieser Sturm vorbei»